Your Title Goes Here
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Strukturen schaffen
Die Ideen und Visionen sind gemeinsam erarbeitet – nun geht es darum, verbindliche Zusagen zu geben, vertragliche Grundlagen zu legen und die Zusammenarbeit mit Kooperationspartner*innen möglichst früh auf sichere Beine zu stellen. Ein kleines Team vor Ort wird aufgebaut – es meistert die Aufgaben, die anstehen. Die Finanzierung als Grundlage der wirtschaftlichen Tragfähigkeit wird geklärt.
Zu mehr Gemeinwohl in der Stadtteilentwicklung beitragen
Bei der gemeinwohlorientierten Stadtteilentwicklung arbeiten verschiedene Partner*innen eng zusammen, um ein nachhaltiges, inklusives und sozial gerechtes Quartier zu gestalten. Die wichtigsten Akteur*innen und ihre Rollen sind:
Eigentümer*innen: Sie spielen eine zentrale Rolle, indem sie ihre Grundstücke und Immobilien über Jahrzehnte für gemeinwohlorientierte Nutzungen zur Verfügung stellen. Nach dem Initialkapital-Prinzip verzichten sie dabei auf die Erhebung der Erbpachtzinsen und stellen damit die entgangenen Einnahmen als Gemeinwohlrendite dem Stadtteil zur Verfügung.
Investor*innen: Sie stellen ihr Geld und oder Neben dem Grundstück wird bei gemeinwohlorientierter Immobilienentwicklung Geld für die Bestandssanierung als Eigenkapital zur Verfügung gestellt, um weitere Finanzierung zu sichern. Nach dem Initialkapital-Prinzip bleibt das Eigenkapital in den Projekten und muss nicht zurückgezahlt werden.
Stadtverwaltung: Häufig sind mehrere Ämter und Behörden der Stadtverwaltung eingebunden, zum Beispiel Planungsamt, Grünflächenamt, Kämmerei, Sozialamt und weitere. Die Stadtverwaltung unterstützt das Projekt mit Planungsrecht, Genehmigungen und die Bereitstellung von Infrastrukturen. Sie kann selbst Grundstücke zur Verfügung stellen und stellt zum Beispiel bei der Beantragung von Städtebaufördermitteln mit Eigenanteilen bereit. Durch diese Vielschichtigkeit ist die Kooperation mit der Stadt eine zentrale Grundlage des Projektes und in Kooperationsvereinbarungen schriftlich festzuhalten. Oberbürgermeister*innen sind häufig zugleich oberste Verwaltungsspitze. Da Gemeinwohlprojekte häufig mehrere Zuständigkeiten berühren, ist es sinnvoll, wenn sie möglichst hoch in der Stadtverwaltung Unterstützung erfahren und eine Ansprechperson auf Seiten der Stadtverwaltung benannt wird.
Gemeinnützige Projektgesellschaft vor Ort: Eine gemeinnützige Gesellschaft (gGmbH) ist bei der Immobilie vor Ort und koordiniert Sanierungsarbeiten und Community Building im Stadtteil. Außerdem baut sie Strukturen für die Verwaltung auf, stellt den laufenden Betrieb sicher und gewährleistet, dass die gemeinnützigen Ziele dauerhaft verfolgt werden. Mehr Informationen zu Aufgaben und Zusammensetzung der gGmbH siehe unten.
Menschen im Stadtteil: Die Bewohner*innen bringen ihre Bedürfnisse, Ideen und Wünsche in den Planungsprozess ein und nutzen und gestalten die Immobilie. Ohne sie kann das Projekt nicht langfristig bestehen.
Lokale soziale Organisationen/Akteure/Vereine: Manche Menschen sind im Stadtteil besonders aktiv oder bereits in Gruppen und Vereinen organisiert oder haben bei sozialen Trägern oder Bildungseinrichtungen einen bestimmten Auftrag. Sie haben wichtiges Fachwissen in sozialen und kulturellen Themen, sind vor Ort vernetzt und leisten wichtige Arbeit. Sie können die Bedarfe im Stadtteil einschätzen und in Kooperationen ihre Schwerpunkte einbringen. Als Multiplikator*innen haben sie Zugang zu einigen Communities.
Lokalpolitik: Vertreter*innen in Bezirks- oder Ortsvertretungen sind häufig lokal engagiert und vernetzt. In ihren regelmäßigen Sitzungen kann das Vorhaben vorgestellt und Rückmeldungen eingeholt werden. Diskussionen in parlamentarischen Gremien tragen auch zur Sichtbarkeit des Projekts bei. Sofern Grundstücke in kommunalem Eigentum Teil des Immobilienprojektes sind, ein neuer Bebauungsplan notwendig ist oder öffentliche Fördergelder beantragt werden, muss der Stadtrat als parlamentarisches Gremium mehrheitlich zustimmen. Vor den Entscheidungen sollten den Fraktionen und Abgeordneten die Projektgrundlagen und -ziele als Entscheidungsgrundlage vorgestellt werden.
Fachexpert*innen: Handwerksunternehmen, Architekturbüros, Landschaftsarchitekt*innen, Stadtentwicklungsbüros und Fachplaner*innen bringen ihr Wissen ein, um die Immobilie zu einem Ort zu machen, der aktuellen Nutzungen Platz bietet, langfristig bestehen kann und den Nutzer*innen Wertschätzung entgegen bringt.
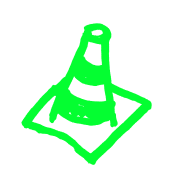
Es hat sich bewährt, Pflichten und Zusagen aller Kooperationspartner möglichst früh im Prozess in verbindlichen Kooperationsvereinbarungen festzuhalten. Früh heißt hier: bevor große Geldsummen zum Beispiel für Architekturleistungen oder Umbauten investiert sind oder Zusagen gegenüber späteren Mieter*innen oder Nutzer*innen gemacht werden.
Eine gemeinnützige GmbH gründen
Im Initialkapital-Prinzip ist die Gemeinnützigkeit nicht zuletzt in den Rechtsform der operativen Projektgesellschaft festgeschrieben: Es wird eine gemeinnützige GmbH (gGmbH) gegründet, um vor Ort aktiv zu sein und das Immobilienprojekt umzusetzen. Anders als bei einer klassischen GmbH steht bei einer gGmbH nicht die Gewinnmaximierung im Vordergrund, sondern sie verfolgt ausschließlich gemeinnützige Zwecke. Was offiziell als gemeinnützig gilt, ist in Deutschland in der Abgabenordnung (AO) festgehalten. Überschüsse müssen reinvestiert werden, um die gemeinnützigen Zwecke zu verfolgen. Im Gesellschaftsvertrag sind die gemeinnützigen Zwecke festgeschrieben und die Gesellschafter genannt.
Muster Satzung gGmbH / Gesellschaftsvertrag gGmbH
In der Projektgesellschaft sind Menschen
Das Team der gGmbH (auch Projektgesellschaft) ist interdisziplinär aufgestsellt und besteht in der Regel aus Geschäftsführung, Officemanager*in, Gemeinwohlmanager*in, Hausmeisterei und Hausverwaltung. In der Planungs- und Bauzeit wird das Team gegebenenfalls durch eine*n technische*n Projektsteuer*in ergänzt. Das Team der Projektgesellschaft ist als eigenständige Wirtschaftseinheit vor Ort tätig. Die Aufgaben reichen von der strategischen Planung über die Umsetzung gemeinnütziger Projekte bis hin zur Finanzverwaltung. Die Geschäftsführung trägt die Gesamtverantwortung und ist verpflichtet, im Sinne der Gemeinnützigkeit zu handeln.
Eine klare Rollenverteilung innerhalb der Organisation stellt sicher, dass die komplexe Aufgabenstellung, gemeinwohlorientiert eine Immobilie umzubauen und im Stadtteil zu verankern, gut erfüllt werden kann. Jedes Teammitglied und jede Rolle ist für die erfolgreiche Umsetzung und den Betrieb einer gGmbH entscheidend. Die Zusammensetzung des Teams, der Kompetenzen und der Zeitressourcen für einzelne Aufgaben ändert sich über die Projektlaufzeit stetig. Nicht immer muss eine Rolle einer (Vollzeit-)Stelle oder Person entsprechen. Mehrere Aufgaben können unter Umständen bei einer Person gebündelt werden.
Your Title Goes Here
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Rollen in der gGmbH
- Geschäftsführung: trägt die Gesamtverantwortung für die Gesellschaft, übernimmt im Umbauprozess der Immobilie die Rolle der Bauherrenvertretung, Budgetplanung, Vertragsmanagement, Personalentscheidungen
- Hausverwaltung / Vermietung: ist ansprechbar in allen Belangen der Hausverwaltung und Vermietung, Erstellung und Verwaltung der Mietverträge, Betriebskostenabrechnung, Rechnungsbearbeitung, Verwaltung der Objektstammdaten, Schlüsselmanagement
- Gemeinwohl-Manager*in: organisiert Veranstaltungen und Beteiligungsformate und halten Kontakt in den Stadtteil, das heißt genauer Entwicklung und Umsetzung von Gemeinwohlprojekten, Community Building, Vernetzung mit lokalen Akteuren, Durchführung von Workshops und Veranstaltungen, Öffentlichkeitsarbeit, unter anderem Erstellung von Kommunikationsmaterialien, Pflege der Website und Social Media, Organisation von Pressekonferenzen
- Facility Management / Hausmeisterei: übernimmt Hausmeistertätigkeiten und ermöglichen ein reibungsloses und gefahrloses Nutzen der Gebäude und Außenflächen, Betreuung und Instandhaltung der Immobilien, Betreuung von kleineren Reparaturarbeiten durch Handwerksunternehmen, Schließdienste
- Office Management: regelt anfallende Organisationsaufgaben, zum Beispiel Rechnungsbearbeitung, Posteingang, Lieferungsmanagement, Terminplanung
- Technisches Projektmanagement: steuert Bauprozesse, das heißt Planung und Überwachung von Bau- und Sanierungsmaßnahmen, Koordination Architekt*innen und Baufirmen, Baubetreuung, Qualitätskontrolle.
- FSJ / BFD
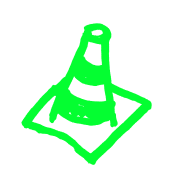
Alle im Team arbeiten gemeinsam auf die Ziele der Gesellschaft und für mehr Gemeinwohl im Stadtteil. Besonders Rollen, die häufig weniger Beachtung finden wie die Hausmeisterei oder das Office Management, sind zentral für den Kontakt zu den Menschen im Stadtteil und den Mieter*innen im Gebäude – und damit für das Gelingen des Projektes.
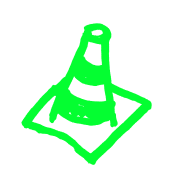
Mit dem Gemeinwohl-Management wird in der gemeinwohlorientierten Immobilienentwicklung ein ganz neuer Position geschaffen: Hier geht es darum, kontinuierlich einen Draht in den Stadtteil zu halten und eine Gemeinschaft aufzubauen. Das geht deutlich über das Abfragen von Planungsvorstellungen und das Präsentieren eines Ergebnisses hinaus – während dem gesamten Bauprozess werden Bedürfnisse geschärft und zwischen Nachbar*innen, Mieter*innen und den Potenzialen der Immobilie vermittelt.
Ein Projektbüro vor Ort ist wichtig
Neben den Menschen ist auch der Ort wichtig – die gGmbH hat ein Büro in der Immobilie selbst oder in unmittelbarer Nähe. Die räumliche Nähe hilft, um den direkten Kontakt zu den Bewohner*innen und Akteuren im Quartier zu gewährleisten. Es entsteht eine Anlaufstelle für Fragen, Anliegen und Ideen und fördert so das Vertrauen und die Teilhabe der Gemeinschaft am Projekt. Das Team hat einen Ort, an dem es sich austauschen kann – denn alle stehen hinter der Vision und der Haltung gegenüber dem Projekt und werden damit verbunden. Durch die Präsenz vor Ort können Entscheidungen schneller getroffen, Probleme rasch gelöst und ein
Liste für ein vor Ort Büro
Neben der Kaffeemaschine stellen weitere Einrichtungsgegenstände eine gute Grundlage dar. Diese Liste bietet eine Grundlage. Bei der Beschaffung kann in Teilen auf Gebrauchtwaren oder Spenden zurückgegriffen werden>
Gut versichert sein
Versicherungen schützen die Organisation vor finanziellen Risiken, die durch unvorhergesehene Ereignisse wie Unfälle, Schäden oder Rechtsstreitigkeiten entstehen können. Eine verlässliche Versicherungsstrategie stellt sicher, dass die gGmbH und das Immobilienprojekt langfristig stabil und handlungsfähig bleiben. Sie ist grundlegender Teil der Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft, den Mitarbeiter*innen und Partner*innen.
Your Title Goes Here
Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.
Wichtige Versicherungen
- Betriebshaftpflichtversicherung: schützt vor Schadensersatzansprüchen Dritter bei Personen- und Sachschäden, die durch das Unternehmen oder seine Mitarbeiter*innen im täglichen Geschäftsbetrieb verursacht werden.
- Rechtsschutzversicherung: übernimmt die Kosten für juristische Auseinandersetzungen, einschließlich Anwalts- und Gerichtskosten, in Fällen von arbeitsrechtlichen oder geschäftlichen Streitigkeiten. Leider kommt es gerade im Planen und Bauen häufiger zu Auseinandersetzung, die anwaltlich geklärt werden – damit die Kosten im Rahmen bleiben, ist die Rechtsschutzversicherung unerlässlich.
- Für Bauen wichtig: Bauherrenhaftpflicht-Versicherung und Bauleistungsversicherung
- Fürs Vermieten wichtig: Haus- und Grundbesitzerhaftpflicht sowie Gebäudeversicherung (Einschluss Feuer, Sturm, Hagel, Leitungswasser, Elementar)
- Inhaltsversicherung: deckt Schäden an der Büroeinrichtung, technischen Geräten und anderen Gegenständen im Projektbüro ab, beispielsweise durch Feuer, Wasser oder Einbruch. Bei Einrichtung des Projektbüros abschließen oder erweitern!
- Elektronikversicherung: spezielle Versicherung für technische Geräte wie Computer, Server und andere elektronische Ausrüstung gegen Schäden durch Bedienungsfehler, Kurzschluss oder äußere Einflüsse. Bei hohen Ausstattungskosten dringend empfehlenswert!
Gemeinnützigkeit nach § 52 AO
Eine gemeinnützige Organisation, zum Beispiel eine gemeinnützige GmbH (gGmbH), darf ausschließlich gemeinnützige Zwecke verfolgen, die der selbstlosen Förderung der Allgemeinheit dienen. Diese Bereiche sind durch die Gesetzgebenden fest definiert und in § 52 der Abgabenordnung (AO) aufgelistet. Die Zwecke, die die Gesellschaft verfolgt, müssen im Gesellschaftsvertrag der gGmbH niedergeschrieben sein und ihre Verfolgung im jährlichen Tätigkeitsbericht beschrieben werden.
Solange die Gemeinnützigkeit besteht, kann die gGmbH von der Körperschaft- (gemäß § 5 Abs. 1 Nr. 9 KStG) und der Gewerbesteuer (§ 3 Nr. 6 GewStG) steuerbefreit werden – sofern keine Gewinne an Gesellschafter ausgeschüttet werden. Es dürfen also keine Einzelpersonen oder Unternehmen wirtschaftliche Gewinne erzielen. Stattdessen müssen alle Überschüsse wieder in die gemeinnützigen Zwecke reinvestiert werden.
Die steuerlichen Vergünstigungen tragen dazu bei, dass die gGmbH ihre gemeinnützigen Ziele effizient und nachhaltig verfolgen kann, indem sie mehr finanzielle Mittel für ihre Projekte zur Verfügung hat.
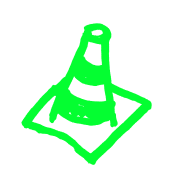
Gemeinnützige Organisationen dürfen Flächen vermieten und betreiben – dabei sind aber sehr enge Grenzen zu beachten und dringend ein*e Steuerberater*in zu Rate zu ziehen. Sind Flächen langfristig (d.h. mehrere Monate) an dieselbe Person oder dasselbe Unternehmen vermietet, zählt das zu Vermögensverwaltung und ist eher unbedenklich. Kurzzeitige Vermietung (z.B. für eine Veranstaltung) gegen Entgelt ist aus steuerrechtlicher Sicht schwierig. Eine Möglichkeit kann hier sein, einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb einzurichten. Dies erfordert eine doppelte Buchhaltung und die Umsätze dürfen nicht die Umsätze im gemeinnützigen Bereich überschreiten. Wir haben uns daher dafür entschieden, dass die Projektgesellschaften keinen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb einrichten.
Vertrag als Grundlage der Kooperation
Die Inhalte einer Kooperation sollten möglichst früh und umfassend vertraglich festgelegt werden, um eine Sicherheit für alle Beteiligten zu geben und Pflichten, Aufgaben und Prozesse zu klären. Dieses Musterdokument ist eine Kooperationsvereinbarung zwischen einer Stadt bzw. Kommune, der gemeinnützigen Projektgesellschaft und der Investorin bzw. Stiftung. Die Vereinbarung beschreibt, wie die Partnerinnen zusammenarbeiten, um ein gemeinwohlorientiertes Quartiersentwicklungsprojekt zu realisieren. Dabei werden die jeweiligen Beiträge und Verantwortlichkeiten der Partner detailliert festgelegt, die Ziele des Projekts erläutert und die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit definiert. Die Vereinbarung legt außerdem fest, auf welchem Weg Konflikte beigelegt und unter welchen Bedingungen die Zusammenarbeit beendet werden kann.
Muster Kooperationsvertrag Stadt
Erläuterungen Kooperationsvertrag Stadt
Kooperationsvereinbarung MUR – gGmbH
Diese Kooperations- und Finanzierungsvereinbarung zwischen der Montag Stiftung Urbane Räume gAG (MUR) und der Projektgesellschaft definiert die Rahmenbedingungen für die gemeinsame Umsetzung eines gemeinwohlorientierten Projekts. Sie regelt die Beiträge beider Partner, die Finanzierung und die Zusammenarbeit, um die festgelegten Ziele zu erreichen. Wichtige Bestandteile sind die Festlegung der Projektziele, die Struktur der Kooperation, die finanzielle Unterstützung und die regelmäßige Überprüfung und Dokumentation des Fortschritts. Die Vereinbarung tritt mit der Unterzeichnung in Kraft und hat eine Laufzeit von [Anzahl] Jahren, mit der Option auf Verlängerung.